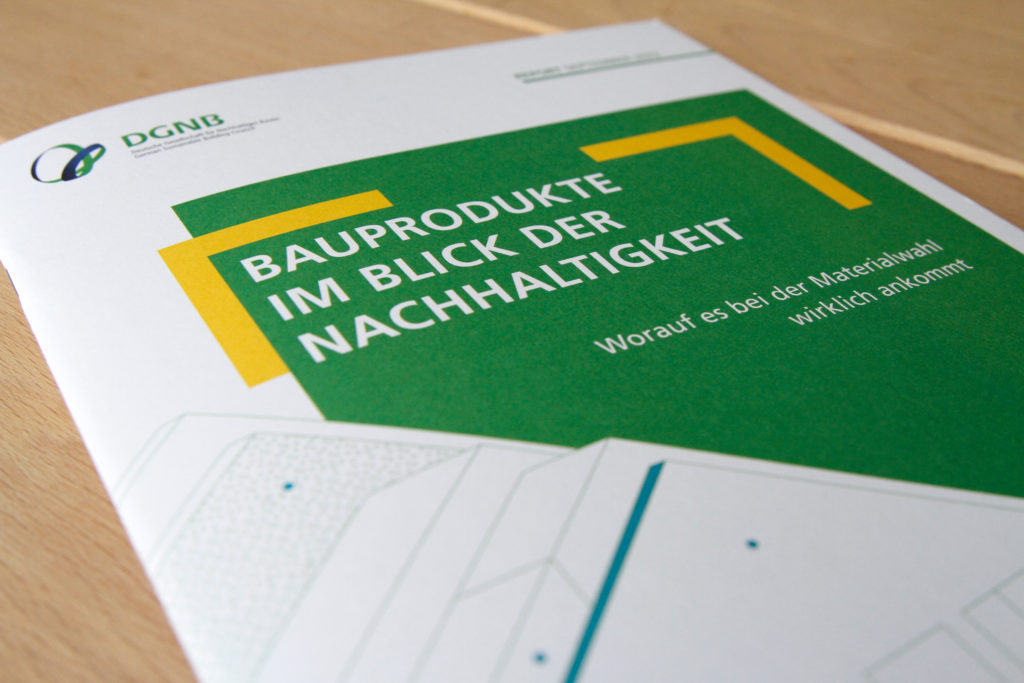Flachdach: Sanieren oder neu machen?
Es ist eine dieser Fragen, die jeden Hausbesitzer, jede Kommune und jeden Planer umtreibt, sobald der Blick nach oben geht: Neuaufbau oder Sanierung – was lohnt sich wirklich?
Ein technisch intaktes Dach zu ersetzen ist in vielen Fällen weder wirtschaftlich noch nachhaltig. Aber eine neutrale Bewertung auf Basis von Fachwissen und Erfahrung zu erhalten, ist gar nicht so einfach. Die reflexartige Antwort lautet oft: Abriss – neues Dach drauf, Thema erledigt. Doch viel zu oft steckt noch erhebliche Substanz in der Fläche.
Wir haben mit Marc Niewöhner, Dachdeckermeister und Sachverständiger, gesprochen und gefragt, wann eine Sanierung lohnender ist als ein Abriss und worauf man achten sollte.
UB: Herr Niewöhner, allen voran steht sicher die Kostenfrage?
Niewöhner: Richtig. Ein Vergleich, angepasst an mittlere Bedingungen, macht deutlich:
- Abriss und Neubau schlagen mit ca. 250–400 €/m² zu Buche, je nach Lage, Ausführung, Material.
- Eine fachgerechte Sanierung liegt meist bei 90–150 €/m², wenn der Bestand noch brauchbar ist und keine gravierenden Folgeschäden vorliegen.
UB: Das klingt nach einem klaren Plädoyer fürs Nachrüsten statt Abreißen.
Niewöhner: Viele ältere Flachdächer – häufig Baujahre 1980–2000er – sind als Warmdach ausgeführt, das heißt: Die Dämmung liegt unter der Abdichtung. Diese konventionelle Bauweise, verbunden mit häufiger Undichtigkeit, hat zu dem bedenklichen Image geführt, das sich bis heute hartnäckig hält. Aber: Der bestehende Aufbau lässt sich oft recht einfach zu einem Plus- bzw. Umkehrdach aufrüsten – dabei liegt die Dämmung über der Abdichtung –, wenn die Abdichtung noch ohne größere Schäden ist. Auf die vorhandene, Abdichtung wird im Bestand ertüchtigt und anschließend wird eine langlebige Lage druckfester Dämmung gelegt, darüber Schutzvlies und eine Auflast aus bestehend aus einer Dachbegrünung oder Kies
UB: Welchen Vorteil bringt dieser umgekehrte Aufbau?
Niewöhner: Die Abdichtung wird dadurch vor UV, Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen geschützt. Die Lebensdauer der Abdichtung erhöht sich durch diese kleine Änderung im Aufbau nachweislich von 20 auf 40 Jahre. Gleichzeitig lässt sich der Dämmstandard auf aktuelle Anforderungen bringen – je nach Ausgangssituation mit Einsparungen von bis zu 30 % bei den Heizkosten. Wir sehen in der Praxis Umkehrdächer aus den 1970er-Jahren, die nach über 50 Jahren noch dicht sind. Genau deshalb ist dieses Prinzip der Schlüssel für nachhaltige Sanierung. Dieses Prinzip passt perfekt zu den Dächern, die schon eine Kiesschüttung als schweren Oberflächenschutz gehabt hatten. Dadurch erhöhen wir die statische Belastung nur gering.
UB: Eine verdoppelte Lebensdauer spart enorm Ressourcen, das leuchtet ein.
Niewöhner: Ja, man kann sagen, das ist Nachhaltigkeit ohne Greenwashing. Wer ein Dach erhält, statt es abzureißen, bewahrt konkret Ressourcen und vermeidet Emissionen, die man klar beziffern kann. Jeder Quadratmeter Dachabbruch bedeutet sehr grob geschätzt 20–60 kg je nach Aufbau und Art des Flachdaches. Eine Sanierung kann schätzungsweise 80–120 kg CO₂/m² einsparen. Ein Dach von 2.000 m² Fläche könnte über seinen Lebenszyklus damit bis zu ca. 200 Tonnen CO₂ sparen.
UB: Vor allem in verdichteten Städten werden Dächer zunehmend zur Ressource: Begrünung, Energiegewinnung, Regenwassermanagement oder Aufenthaltsflächen – all das zeigt, dass von Dächern in Zeiten des Wandels offenbar mehr erwartet wird, als nur das Gebäude abzudichten?
Niewöhner: Absolut. Flachdächer haben enormes Potenzial, wenn man es richtig macht. Damit diese Potenziale genutzt werden können, braucht es eine fundierte Bestandsanalyse. Und in den kommenden Jahren wird neutrale und fachlich qualifizierte Beratung immer wertvoller. Viele Sachverständige gehen in den Ruhestand, Nachwuchs ist rar.
UB: Wir haben nun gesehen: Sanierung spart Kosten, Ressourcen und ist nachhaltiger. Aber ist das auch in jedem Fall möglich?
Niewöhner: Eine berechtigte Frage. Viele Dächer sehen von oben schlimm aus, sind in der Substanz aber völlig intakt. Dachdecker entscheiden zwar projektbezogen, doch für viele Betriebe ist ein Neubau einfacher kalkulierbar, standardisierter und mit weniger Haftungsrisiken verbunden als eine komplexe Sanierung. Bauherren fehlt deshalb häufig die neutrale Zweitmeinung. Dabei zeigt sich oft: Ein als „fällig“ eingestuftes Dach kann nach Analyse durch einen Sachverständigen noch Jahrzehnte genutzt werden
Um zu entscheiden, ob ein Dach weiter genutzt oder ersetzt werden muss, sollten folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
- Kernbohrungen: Sie geben Aufschluss über den Schichtaufbau.
- Feuchtemessungen: Hier zeigt sich der Zustand der Dämmung.
- Statische Berechnungen: Sie klären, ob zusätzliche Lasten durch Dämmung, Kies oder Platten sicher getragen werden können.
- Materialbeprobung zur Ermittlung des Zustandes der vorhandenen Abdichtung
- Welche Maßnahmen wären notwendig, um den heutigen Stand der Regelwerke darzustellen
Das Ergebnis solcher Prüfungen überrascht häufig – und entscheidet, ob ein Dach weiter trägt oder tatsächlich erneuert werden muss. Der Mehrwert einer unabhängigen Bewertung liegt auf der Hand: Sie macht Sanierungskosten verlässlich kalkulierbar, weist die Substanz des Bestands nach und zeigt, welche weiteren Nutzungsmöglichkeiten im Dach stecken – etwa Photovoltaik, Begrünung oder Regenwassermanagement.
Am Ende geht es darum, das in unseren Dächern schlummernde Potenzial nicht liegen zu lassen, sondern klug zu nutzen.
UB: Wir danken Marc Niewöhner für das Gespräch. Für weitere Fragen steht er auch in seiner Funktion als Geschäftsführer beim IQDF – Interessengemeinschaft Qualitätsmanagement Dach- und Flachdachabdichtungen – zur Verfügung. (Kontaktdaten)

Geschäftsführer beim IQDF – Interessengemeinschaft Qualitätsmanagement Dach- und Flachdachabdichtungen